Leica SL 3 Topseller
Dank ihrer robusten Bauweise und wetterfesten Versiegelung ist die Leica SL 3 ideal für den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen geeignet. Ihre höhere Bildgeschwindigkeit und der Serienbildmodus ermöglichen es, keine Szene zu verpassen. Auch im Bereich Videoaufnahmen setzt sie neue Standards mit erweiterten Funktionen in 4K-Qualität.
Die erweiterte Konnektivität durch WiFi und Bluetooth ermöglicht eine nahtlose Integration in Dein digitales Leben. Zudem wurde das Energiemanagement der Leica SL 3 optimiert, um eine längere Akkulaufzeit zu gewährleisten. Das benutzerfreundliche Interface und die intuitive Menüführung machen die Nutzung der Kamera besonders angenehm.
- Die Leica SL 3 bietet verbesserte Bildqualität dank neuer Sensor-Technologie und detailgetreuer Farbwiedergabe.
- Fortschrittliches Autofokus-System für präzise, schnelle Aufnahmen bei phasen- und kontrastbasierter Fokussierung.
- Robuste Bauweise und wetterfeste Versiegelung für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
- Erweiterte Videoaufnahmen in 4K-Qualität mit professionellen Funktionen und optimierter Bildgeschwindigkeit.
- Erweiterte Konnektivität durch WiFi und Bluetooth sowie optimiertes Energiemanagement für längere Akkulaufzeit.
Verbesserte Bildqualität durch neue Sensor-Technologie
Die Leica SL 3 beeindruckt mit einer verbesserten Bildqualität dank modernster Sensor-Technologie. Der neue Sensor ermöglicht eine höhere Detailgenauigkeit und eine erweiterte Farbwiedergabe, wodurch Deine Aufnahmen lebendig und realistisch wirken.
Empfehlung: Fujifilm Sofortbildkamera: Retro trifft Moderne
Leica SL 3 weitere Top Produkte
Fortschrittliches Autofokus-System für präzise Aufnahmen


Leica SL 3: Die neue Generation der Spiegellosen
Das fortschrittliche Autofokus-System der Leica SL 3 sorgt für präzise Aufnahmen, indem es eine Vielzahl von Fokuspunkten nutzt. Dank der schnellen und zuverlässigen Erkennung von Motiven werden selbst schnelle Bewegungen scharf abgebildet. Die Kombination aus phasenbasierter und kontrastbasierter Fokussierungstechnologie ermöglicht zu jeder Zeit optimale Ergebnisse.
Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut. – Henri Cartier-Bresson
Leica SL 3 neu dabei
Robuste Bauweise und wetterfeste Versiegelung
Die Leica SL 3 bietet eine extrem robuste Bauweise, die für anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten entwickelt wurde. Dank der wetterfesten Versiegelung kannst Du Dich darauf verlassen, dass die Kamera auch unter widrigen Bedingungen einwandfrei funktioniert. Dies ist besonders wichtig für Außenaufnahmen und Reisen, da die wetterfeste Versiegelung Staub und Feuchtigkeit effektiv abhält.
Höhere Bildgeschwindigkeit und Serienbildmodus
Mit der neuen Leica SL 3 kannst Du endlich von einer erheblich höheren Bildgeschwindigkeit profitieren. Der verbesserte Serienbildmodus ermöglicht es Dir, eine größere Anzahl an Aufnahmen in kürzerer Zeit zu machen. Dies ist besonders nützlich für Sport- und Actionfotografie, bei der jeder Moment zählt. Dank der neuen Sensor-Technologie und dem fortschrittlichen Autofokus-System wird jede Aufnahme gestochen scharf und detailreich sein. Die Kombination aus schneller Bildverarbeitung und effizientem Energiemanagement macht die Leica SL 3 zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Fotografen.
Auch interessant: Sony Alpha 7 IV Test: Modernste Technik im Test
| Funktion | Vorteile | Bewertung |
|---|---|---|
| Verbesserte Bildqualität | Neue Sensor-Technologie sorgt für höhere Detailgenauigkeit und erweiterte Farbwiedergabe. | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Autofokus-System | Präzise und schnelle Aufnahmen durch phasen- und kontrastbasierte Fokussierung. | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Robuste Bauweise | Wetterfeste Versiegelung schützt vor Staub und Feuchtigkeit. | ⭐⭐⭐⭐ |
Erweitertes Videoaufnahmesystem in 4K-Qualität


Erweitertes Videoaufnahmesystem in 4K-Qualität – Leica SL 3: Die neue Generation der Spiegellosen
Mit der Leica SL 3 kannst Du Deine Kreativität auf ein neues Niveau heben, dank des erweiterten Videoaufnahmesystems in 4K-Qualität. Diese beeindruckende Kamera ermöglicht es dir, Videos in atemberaubender Auflösung aufzunehmen, und das bei einer hervorragenden Bildrate. Die professionellen Videofunktionen sorgen dafür, dass jedes Detail gestochen scharf ist und Farben lebendig dargestellt werden.
Ergänzende Artikel: Nikon D70: Rückblick auf einen digitalen Klassiker
Erweiterte Konnektivität mit WiFi und Bluetooth
Die Leica SL 3 bietet erweiterte Konnektivität, die es ermöglicht, Fotos und Videos schnell und einfach zu teilen. Mit integriertem WiFi und Bluetooth kannst Du Deine Aufnahmen nahtlos auf Dein Smartphone oder Tablet übertragen. Dies erleichtert nicht nur das Teilen in sozialen Medien, sondern auch das Sichern Deiner Bilder auf verschiedenen Geräten. Dank der stabilen kabellosen Verbindung wird die Datenübertragung zu einem Kinderspiel, sodass Du mehr Zeit für Deine Kreativität hast.
Optimierte Akkulaufzeit und Energiemanagement
Die Leica SL 3 bietet eine erheblich optimierte Akkulaufzeit, die es Fotografen ermöglicht, länger ohne Unterbrechung zu arbeiten. Mit einem verbesserten Energiemanagementsystem nutzt die Kamera die verfügbare Energie effizienter und minimiert so den Stromverbrauch während des Betriebs. Dies ist besonders nützlich bei längeren Fotosessions oder Videoaufnahmen, wo durchgehende Leistung erforderlich ist.
Benutzerfreundliches Interface und Menüführung
Die Leica SL 3 besticht nicht nur durch ihre technischen Spezifikationen, sondern auch durch das benutzerfreundliche Interface. Dank der intuitiven Menüführung findest Du Dich schnell zurecht, selbst wenn Du nicht zu den erfahrensten Fotografen gehörst. Alle wichtigen Funktionen sind übersichtlich angeordnet und in kürzester Zeit erreichbar. Die Anpassung von Einstellungen erfolgt unkompliziert und erlaubt es Dir, Dich voll und ganz auf Deine Fotografien zu konzentrieren.



![Mr.Shield Schutzfolie Kompatibel mit Leica SL3 / SL 3-S / SL2-S / SL2S / SL2 [3 Stück] Schutzglas Schutzglasfolie 9H Härte, HD Klare Displayschutzfolie](https://m.media-amazon.com/images/I/41LorrmBKQL._SL160_.jpg)


![BROTECT 3 Stück Schutzglas für Leica SL3 / SL3-S (Display + Schulterdisplay) Schutzfolie Panzer Folie Glas Displayschutz Made in Germany [ 9H, Anti-Fingerprint]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Ib1cVsInL._SL160_.jpg)










































































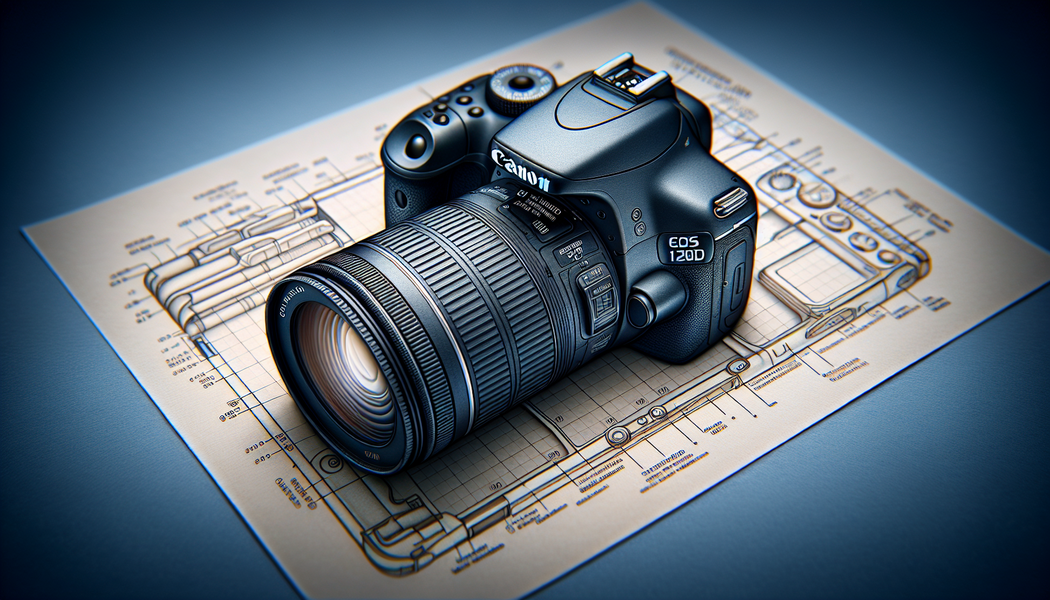




















![ULBTER Displayschutz schutzfolie für Sony Alpha 7 IV A7 IV A7M4 A7IV screen protector folie 9H Härte Gehärtetes Glas [3+2 Stück]](https://m.media-amazon.com/images/I/51S8UTn2XDL._SL160_.jpg)







































